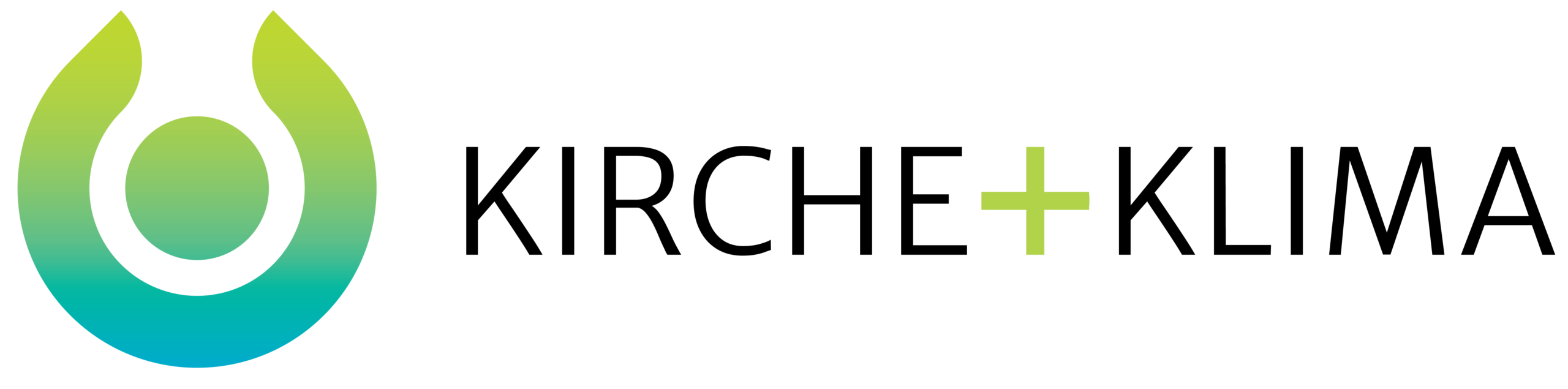Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) hat am Mittwoch, den 25. Oktober im Haus Villigst in Schwerte den Klimaschutzplan EKvW einstimmig beschlossen. Der Plan wurde in einen partizipativen Prozess mit Aktiven aller kirchlichen Ebenen entwickelt und benennt Strategie, Maßnahmen und Verantwortliche zur Erreichung der Netto-Treibhausgasneutralität bis 2035 und hat eine Laufzeit bis 2027.


Informationsmaterial zum Klimaschutzplan
- Klimaschutzplan, Broschüre
- Klimaschutzplan, Textform
- Klimaschutzplan, Excel-Tabelle Meilensteine
- Klimaschutzplan, Präsentation (Video)
- Klimaschutzplan, Präsentation (PDF)
- Klimaschutzplan, Pressemitteilung
- Klimaschutzplan, Erklärvideo Handlungsbereich Organisation
- Klimaschutzplan, Erklärvideo Handlungsbereich Gebäudestrategie
- Klimaschutzplan, Erklärvideo Handlungsbereich Gebäudeeffizienz
- Klimaschutzplan, Erklärvideo Handlungsbereich Erneuerbare Energien
- Klimaschutzplan, Erklärvideo Handlungsbereich Mobilität
- Klimaschutzplan, Erklärvideo Handlungsbereich Beschaffung
- Klimaschutzplan, Erklärvideo Handlungsbereich Kirchenland
- Klimaschutzplan, Erklärvideo Handlungsbereich Bildung und Kommunikation
Was steht im Klimaschutzplan?
Den Kern des Klimaschutzplans bilden Maßnahmen für die acht Handlungsbereiche Organisation, Gebäudestrategie, Gebäudeeffizienz, Erneuerbare Energien, Mobilität, Beschaffung, Kirchenland sowie Bildung und Kommunikation. Dabei werden die Maßnahmen benannt und im Meilenstein-Format jeweils Zuständigkeiten zugewiesen. Ein Anhang enthält Unterstützungswerkzeuge wie bspw. Bilanzierungsstandards, Standards zur Erstellung kreiskirchlicher Klimaschutzkonzepte und eine Handreichung zur Verwendung der Klimapauschale. Den beschlossenen Wortlaut des Klimaschutzplans finden Sie auf folgenden Seiten: