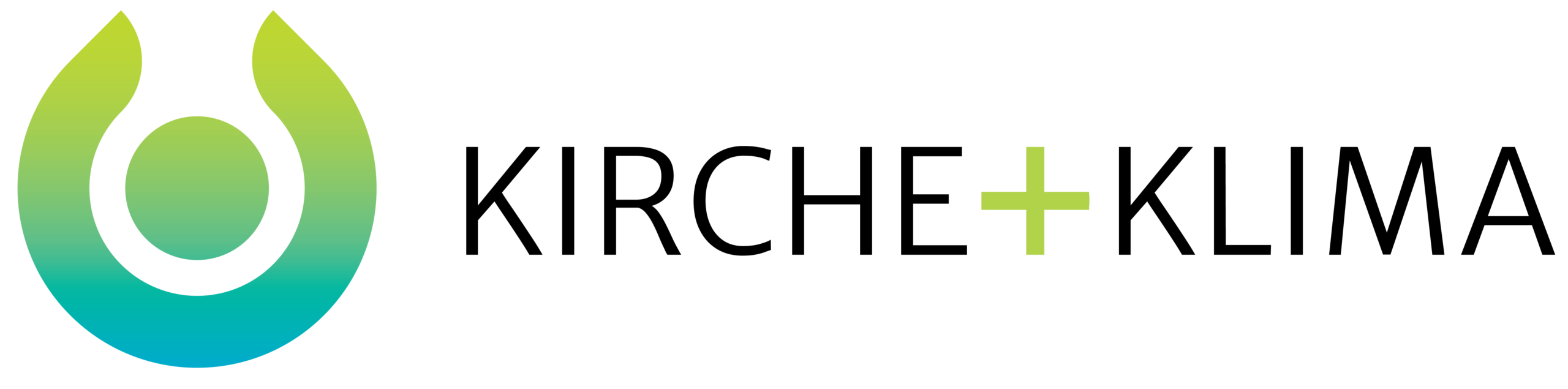Wie und von wem wird die Bilanz erstellt?
Die Kreiskirchenämter listen die Energieverbräuche der einzelnen Gebäude auf. Diese basieren auf Zählerablesungen oder Abrechnungen der Energieversorger. Das Klimabüro der EKvW berechnet mit Hilfe der Klimafaktoren für die Energieträger die CO2-Emissionen aus. Diese werden dann gruppiert nach Kirchenkreis und Nutzungsart. Das Klimabüro der EKvW übermittelt die Energieverbräuche an die FEST (Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft e. V.), die die Bilanz der Evangelischen Kirchen von Deutschland berechnet.